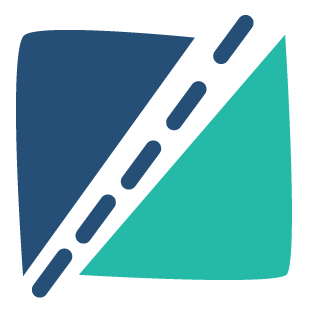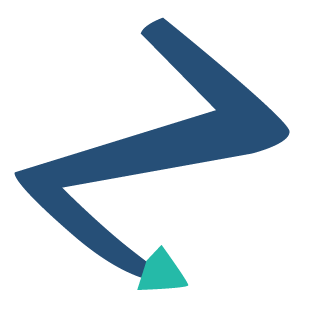Energierecht mit Weitblick – von Anfang an auf Kurs
Das Energierecht ist kein starres Spezialgebiet, sondern ein Querschnitt aus Planungs-, Umwelt-, Immissionsschutz- und Förderrecht.
Besonders bei Vorhaben im Bereich Windenergie, Photovoltaik, Batteriespeichersystemen, Wasserstoff, KWK oder Netzinfrastruktur braucht es ein rechtssicheres Fundament und jemanden, der zwischen gesetzlichen Anforderungen und behördlicher Praxis vermittelt.
Wir arbeiten daran, Projekte so vorzubereiten und zu begleiten, dass keine juristische Schieflage entsteht und Vorhaben nicht an Verfahrensdickicht oder unklarer Zuständigkeit scheitern.
Bereits in der Frühphase von Projekten sind rechtliche Weichen zu stellen – etwa bei der Flächensicherung oder beim Netzanschlussbegehren. Letzterer ist mittlerweile ein zentraler Engpass bei vielen Projekten: Anschlussfristen werden überschritten, Zuständigkeiten sind unklar, und die rechtliche Durchsetzung gegenüber Netzbetreibern ist oft komplex.
Wir begleiten unsere Mandanten während der gesamten Projektlaufzeit, d.h. wir unterstützen von der Flächensicherung bis zur Durchsetzung des Netzanschlusses. Auch nach Inbetriebnahme der Anlage beraten wir beim Verkauf und der Vertragsgestaltung und setzen für unsere Mandanten Ansprüche zum Beispiel gegen Käufer oder Netzbetreiber, auch zu Fragen im Zusammenhang mit Redispatch durch.